 Die
Lehre des Buddha von Max Ladner
Die
Lehre des Buddha von Max Ladner
Wiedergeburt
Der Ausdruck "Wiedergeburt" ist wohl sehr bequem im Gebrauch, aber er entspricht nicht ganz dem, was der Buddhismus darunter versteht. Wiedergeboren wird nicht ein Wesen, nicht eine unsterbliche Seele, ein Ich an sich, oder gar etwa die leiblich-geistige Persönlichkeit, wie sie da steht. Nicht einmal psychische Zustände werden wiedergeboren, denn dann müssten es ja genau dieselben sein, die schon da waren; das aber gibt es nicht, denn 'sabbe sankhara anicca', alle Gestaltungen sind vergänglich. Eine Textstelle möge uns zeigen, wie dies gemeint ist. Da haben wir z.B. ein Gespräch aus dem Milinda-Panha, zwischen dem König Milinda und dem buddhistischen Mönch Nagaseno:
"Der König sprach: 'Gibt es wohl, ehrwürdiger Nagaseno, irgend ein Wesen, das beim Tode von dem einen Körper in einen anderen Körper hinüberwandert?'
'Nein, o König.'
'Wenn dies sich aber so verhält, o Herr, entgeht man denn dadurch nicht der Folge böser Taten?'
'Wenn man nicht mehr wiedergeboren wird, dann wohl. Solange man aber noch wiedergeboren wird, entgeht man nicht der Folge böser Taten.'
'Erkläre mir dies!'
'Wenn da irgend ein Mann von einem anderen Mangos weggestohlen hätte, verdiente der wohl Strafe?'
'Gewiss verdiente er Strafe, o Herr.'
'Wieso denn? Er hat doch gar nicht jene Mangos gestohlen, die der andere gepflanzt hat.'
'Jenen (gepflanzten) Mangos aber zufolge sind diese (gestohlenen) Mangos entstanden. Darum eben verdient er Strafe.'
'Ebenso auch, o König, werden durch diese geistig-körperliche Verbindung gute oder böse Taten gewirkt, und zufolge jener Taten entsteht eine neue geistig-körperliche Verbindung. Darum eben entgeht man nicht der Folge böser Taten.'
'Weise bist du, ehrwürdiger Nagaseno!'
Besonders die Schlussworte Nagasenos, "zufolge jener Taten entsteht eine neue geistig-körperliche Verbindung", geben einen tiefen Einblick in die buddhistische Wiedergeburtslehre.
Die Dauer der Persönlichkeit
Aus dem Paticca-samuppada, dem Gesetz der ursächlichen Entstehung, kennen wir die Bedingungen der Geburt: Werden, Anhaften, Durst usw., und wir wissen auch, dass diese Bedingungen nicht so zu verstehen sind, als wäre im absoluten Sinne ein Werdender da, ein Anhaftender, ein Dürstender usw., als Träger dieser Faktoren. Nein, das sind alles nur Zustände, nichts als karmisch bedingte Zustände, die sich in der "Person" zu einem individuellen Dasein verdichtet haben, ohne dass da eine absolute Wesenheit zu finden oder auch nur irgendwie notwendig wäre.
Wenn wir die Persönlichkeit, wie sie in Erscheinung tritt, als ein seiendes, bleibendes Wesen ansehen würden, wäre das offensichtlich ein Irrtum, denn in Wirklichkeit bestehen wir aus einer steten Aufeinanderfolge von Bewusstseins-Momenten, d.h. unser Wesen besteht nur solange, als ein Bewusstseins-Moment besteht.
Der vergehende Moment gebiert schon wieder einen neuen, nicht den gleichen, aber auch keinen völlig anderen, denn der eine ist Bedingung für den anderen. Solange die Ursachen bestehen, solange wiederholt sich dieser Prozess, resp. solange verwirklicht er sich. Ein diesbezügliches Gleichnis aus dem Kanon möge die Sache noch näher beleuchten:
"Wenn jemand eine Lampe anzündet, könnte dieselbe die ganze Nacht brennen? - Ja. - Ist die Flamme in der ersten Nachtwache dieselbe wie in der zweiten? - Nein. - Ist die Flamme während der zweiten Nachtwache dieselbe wie in der dritten? - Nein. - Dann sind es wohl verschiedene Flammen, die in den verschiedenen Nachtwachen brennen? - Nein, die Flamme genährt durch das Öl in derselben Lampe brannte die ganze Nacht. - Ebenso geht es mit den lebenden Wesen. Einer stirbt, einer wird geboren; ohne Unterbrechung folgt eine Existenz der anderen, ebenso wie die Bewusstseinsmomente während des Lebens einer dem anderen folgen."
Der ewige Wechsel
Wir sind nie ganz gleich, auch nicht während zwei Augenblicken, die aufeinander folgen, weder in körperlicher noch in geistiger Hinsicht; aber die Differenzen, die Unterschiede, die Veränderungen können sehr klein sein, so dass sie vielleicht überhaupt erst nach längerer Zeit bemerkbar sind.
Die Biologie stellte fest, dass sich jeder Teil des Körpers innerhalb von sieben Jahren vollständig erneuert; aber der Geist ändert sich in bedeutend kürzerer Zeit. Darum sagt der Buddha: "Es wäre richtiger, den Körper als beständig zu betrachten, statt den Geist, weil jener sich weniger schnell ändert." Diese unaufhörlichen Veränderungen sind das Kennzeichen des Lebens. Entstehen und Vergehen sind nur die beiden Seiten desselben. Tod und Geburt sind nur die beiden Seiten eines Vorganges. Was hier verschwindet, erscheint dort wieder, und es ist anzunehmen, dass zwischen Tod und Geburt weder die Gesetze des Raumes noch der Zeit Geltung haben. Darum sind alle Keime der Welt dem Durst nach Anhaften, nach Werden, gleich weit entfernt und gleich nahe. Wie das Feuer mit geisterhafter Allgegenwart nur auf die Bedingungen seines Aufflammens wartet, ganz gleich, ob sie hier oder in unendlicher Entfernung in Erscheinung treten, so besteht für den Durst nach Dasein keine räumliche und zeitliche Grenze. Er wird dort einsetzen, wo er den passenden Stoff findet, sei es im Menschenreich, mit seinen unzähligen Variationen, sei es im Tierreich, in Bereichen noch ungünstigerer Bedingungen, oder in der Welt der Götter.
Aber auch dieser "Durst nach Dasein" ist kein "Ding an sich". Er ist ebenso abhängig, wie alle anderen Glieder der Kausalkette.
Es wäre noch vieles zu sagen, z.B. über die buddhistische Meditations-Praxis, über die Psychologie und Ethik des Buddhismus, über den Sangha, die Gemeinde der Mönche und Nonnen, über die verschiedenerlei Sekten, die sich gebildet haben, speziell über das Mahayana und seine Philosophie usw. usw., das würde aber viel zu weit führen und den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Etwas aber dürfen wir nicht übergehen, und das ist ein kurzer Überblick über das Schrifttum des alten, ursprünglichen Buddhismus, den Pali-Kanon.
Der Pali-Kanon
Die Wissenschaft hat sich sehr eingehend mit der Sprache und der Herkunft dieser Texte befasst, sie hat sie hinsichtlich ihres dokumentarischen Wertes mit den chinesischen und tibetanischen und besonders mit den Sanskrit-Texten, auf die sich speziell der Mahayana-Buddhismus stützt, verglichen und ist dabei zum Schluss gekommen, dass einzig die Pali-Texte für das massgebend sein können, was der Buddha wirklich gelehrt hat.
So sagt z.B. Prof. Winternitz in seiner Einleitung zum "Der ältere Buddhismus": "Soviel ist sicher, dass weder die nepalesische buddhistische Sanskritliteratur noch die buddhistische Literatur von Tibet und China an Altertümlichkeit und Ursprünglichkeit dem Pali-Kanon auch nur einigermassen gleichkommt, und dass das Älteste und Ursprünglichste, was wir in nepalesischen, tibetischen und chinesischen Texten finden, stets das ist, worin sie mit den Pali-Texten übereinstimmen."
Prof. Walleser von der Heidelberger Universität bemerkt in seinem Buche "Die philosophische Grundlage des älteren Buddhismus"-. "Den einzigen Aufschluss über die persönlichen Lehren und Anschauungen Buddhas können nur dessen Reden und Gespräche gewähren, und so mag es als keiner weiteren Rechtfertigung bedürftig erscheinen, wenn wir die Erörterung der philosophischen Grundlage des ursprünglichen Buddhismus an den Sutta-pitaka des Pali-Kanons anschließen."
Dr. Wolfang Bohn bemerkt in der Einleitung zu seinem Buche "Die Psychologie und Ethik des Buddhismus": "Die Kenntnis des reinen, das heisst von späteren ausserindischen Zutaten freien Buddhismus schöpfen wir aus dem sogenannten Pali-Kanon."
Der Kanon selber führte den Namen "Tipitaka", d.h. "Dreikorb", und zwar deshalb, weil er in drei Abteilungen zerfällt. Vielleicht wurde jede Abteilung der auf Palmblätter geschriebenen Texte seinerzeit in einem Korb aufbewahrt. Dies wäre wenigstens eine Erklärung für die eigenartige Benennung. Diese drei Abteilungen bestehen aus dem
- Vinaya-Pitaka, dem Buch der Moralvorschriften,
- Sutta-Pitaka, dem Buch der Lehrreden,
- Abhidhamma-Pitaka, dem Buch der Psychologie und Philosophie.
Diese großen Abteilungen zerfallen wieder in mehrere Unterabteilungen. Die wichtigsten und aufschlussreichsten Texte bilden das Sutta-Pitaka: Es zerfällt in die fünf Nikayas oder Sammlungen und zwar:
- den Digha-Nikaya, die Sammlung der langen Lehrreden,
- den Majhima-Nikaya, die Mittlere Sammlung, oder die Sammlung der mittellangen Lehrreden,
- den Samyutta-Nikaya, die Sammlung einander verwandter Lehrreden,
- den Anguttara-Nikaya, die vom zahlenmäßigen Gesichtspunkt aus aneinandergereihte Sammlung von Reden,
- den Khuddaka-Nikaya, die kleine Sammlung, zu der verschiedene Bücher gehören, wie das Dhammapadam, die Lieder der Mönche und Nonnen, die Jatakas usw.
Den grössten Teil dieser Texte besitzen wir heute auch in deutscher Sprache, und da sind es besonders die Übersetzungen Karl Eugen Neumanns, die wohl dem Urtext, was Schönheit des sprachlichen Ausdrucks und sinngemässe Genauigkeit anbelangt, am nächsten kommen.
Schluss
Wer den Kanon gedanklich unvoreingenommen studiert, der erkennt, dass dessen Grösse in seinem kompromisslosen, unbestechlichen Wirklichkeitsgehalt liegt. Es ist der Atem der Wirklichkeit, der aus ihm entgegenweht. Seine oft nüchternschwerfälligen Gedankenreihen erheben das Herz und geben so unendlich viel, dass auch die erlesensten Leckerbissen antiker und moderner Philosophen, die Erhabenheiten östlicher und westlicher Religionen, einfach liegen gelassen werden, weil diese alle noch "einen Erdenrest, zu tragen peinlich" besitzen.
Wir schließen mit einer Feststellung Karl Eugen Neumanns: "Als Gesamtbild der Kultur steht Indien unerreicht da; und dieser Jahrtausende alten, tiefwurzelnden, unendlich mannigfaltigen Kultur edelste Frucht ist der Buddhismus."
Der Autor
Max Ladner wurde am 11. Dezember 1889 in Brixen im Südtirol geboren. Er kam kurz vor dem ersten Weltkrieg in die Schweiz, wo er als Bauingenieur tätig war. 1919 heiratete er in Baden Rosa Suter. 1929 zog das Paar mit dem Sohn Max nach Zürich. Zum Buddhismus kam Ladner über Schopenhauer und Nietzsche. Anfänglich gehörte er zum Kreis um Georg Grimm, den er regelmäßig in München besuchte. 1936 überwarf er sich mit Grimm und am 5. Dezember 1942 gründete er zusammen mit Raoul von Muralt die Buddhistische Gemeinde Zürich, die monatlich in Ladners Haus zusammenkam. Von 1948 bis 1961 gab er "Die Einsicht" heraus, die damals wichtigste deutschsprachige buddhistische Zeitschrift. 1933 veröffentlichte er "Nietzsche und der Buddhismus" und 1948 das Hauptwerk "Gotamo Buddha". 1952 schließlich erschien "Wirklichkeit und Erlösung". Daneben publizierte er zahlreiche Artikel und führte eine rege Korrespondenz mit Buddhisten in der ganzen Welt, so mit Nyanatiloka, Nyanaponika und Lama Govinda. Er starb am 23. Oktober 1963 in Zürich-Witikon.
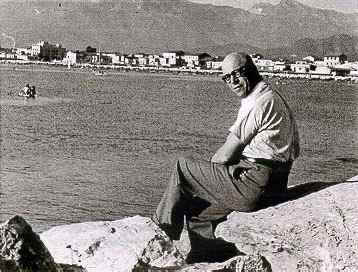
Nachwort
Seit dem Erscheinen der vorliegenden Schrift sind mehr als fünfzig Jahre vergangen und es gibt heute unzählige Einführungen in den Buddhismus. Wenn wir uns trotzdem entschlossen haben, "Die Lehre des Buddha" neu herauszugeben, so vor allem deshalb, weil dieses Werk einen ausgezeichneten Überblick über den Buddhismus bietet, und das in kürzester Form. Es handelt sich dabei nicht um eine gelehrte Abhandlung, sondern um eine persönlich gefärbte Darstellung, bei der die Begeisterung und Freude des Verfassers an der Lehre spürbar mitschwingt. Als Dokument aus der Zeit der Anfänge des Buddhismus in der Schweiz ist diese Schrift sicher auch von historischem Interesse. Schließlich ist "Die Lehre" für uns ein Stück Familienerbe und hat als solches nicht nur sentimentalen Wert - eine Neuausgabe ist für uns auch eine Danksagung an unseren Vater bzw. Großvater, durch den wir zum Buddhismus gekommen sind.
Es wurden keine bedeutenden Änderungen am Original vorgenommen. Auf die Verwendung von Längezeichen (z.B. Pāli statt Pali) wurde bewusst verzichtet. Aus dem Text geht klar hervor, dass der Autor dem ursprünglichen Buddhismus (Theravada) zuneigt, was auch seine Verwendung von Pali-Ausdrücken erklärt, insbesondere Nibbāna statt Sanskrit Nirvana (dagegen Sanskrit Karma statt Pali Kamma). Wir wollen keine Stellung beziehen zur Frage, ob die auf dem Pali-Kanon basierende Lehre dem Mahayana-Buddhismus vorzuziehen sei.
Max F. Ladner und Kathrin Cooper-Ladner Pfaffhausen, Februar 1999